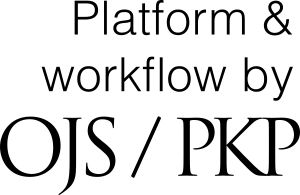Archive - Seite 3
-

Rekrutierung musikalischer Eliten. Knabengesang im 15. und 16. Jahrhundert
Bd. 10 (2011)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Wollte man eine Soundscape von Musik der Renaissance erstellen, dürfte der Klang von Knabenstimmen keinesfalls fehlen. Vor allem Musik im Kirchenraum, wo Frauen ihre Stimme nicht erheben durften, aber auch Musik bei Hofe, im Theater und in Bildungsinstitutionen rechnete fest mit den teils exquisit geschulten jungen Sängern, aus denen in der Regel die spätere Komponisten-Elite hervorging. Der interdisziplinär angelegte Band geht dem Phänomen in vielfältiger Weise nach: Vor dem Hintergrund allgemeiner Vorstellungen von Kindheit in Spätmittelalter und Früher Neuzeit werden die institutionellen Strukturen rekapituliert und die Lehrschriften erkundet, in denen sich niederschlägt, wie das Lernen didaktisch zu bewältigen war. Die pädagogischen und klanglichen Ideale und Ideologien, die sich mit den jungen Stimmen verbanden, werden in ihrer physiologischen, aufführungspraktischen und ästhetischen Dimension be- und hinterfragt. Auch ikonographisch wird das »Bild« des singenden Knaben auf den Prüfstand gestellt.
-

Normierung und Pluralisierung. Struktur und Funktion der Motette im 15. Jahrhundert
Bd. 9 (2010)Herausgegeben von Laurenz Lütteken unter Mitarbeit von Inga Mai Groote.
Die Gattung der Motette hat im 15. Jahrhundert einen bedeutenden Wandel erlebt. Für die Zeit um 1400 lässt sich noch relativ leicht eine normative Formulierung des Gattungsparadigmas erkennen, und zwar in den komponierten Werken selbst. In der Zeit um 1500 ist die Situation bis zur Unübersichtlichkeit schwierig – ohne dass damit ein Verlust an Systematik verbunden gewesen ist. Der hier angedeutete Prozess, der etwa die Zeit zwischen Dufays Geburt und den ersten gedruckten Motettenbüchern Petruccis umfasst, ist in der Forschung des öfteren beschrieben worden. Doch sind Erklärungsmodelle bisher praktisch nicht erprobt worden. Offenbar hängt die erstaunlich feinnervige Pluralisierung der Gattung im 15. Jahrhundert zusammen mit einer ebenso subtilen funktionalen Differenzierung, die abhängig ist von Institutionen, liturgischen, para- oder außerliturgischen Kontexten, von poetologischen, zeremonialen und regionalen Besonderheiten, schließlich von den Modi der Aufzeichnung und der Distribution. Der bedeutende Strukturwandel lässt sich folglich als Interaktion der verschiedensten Parameter verstehen. An diesem Punkt setzen die hier veröffentlichten Beiträge an, wobei erstmals versucht wird, dieser Interaktion dezidiert nachzuspüren.
-
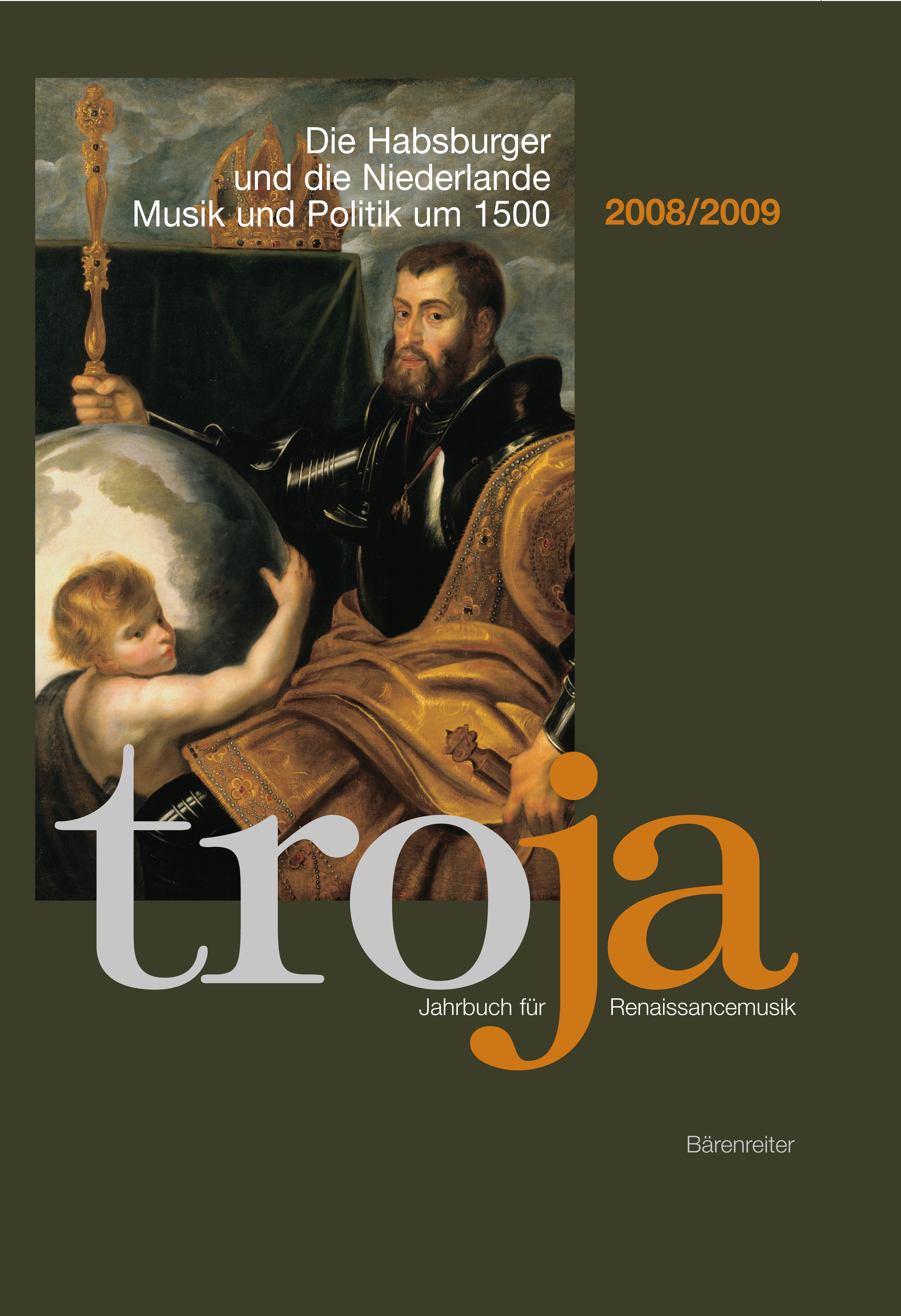
Die Habsburger und die Niederlande. Musik und Politik um 1500
Bd. 8 (2009)Herausgegeben von Jürgen Heidrich.
2009 jährte sich zum 550. Mal der Geburtstag Kaiser Maximilians I. von Habsburg (1459–1519). Der so genannte »letzte Ritter« repräsentierte einerseits das Ideal des untergegangenen burgundischen Rittertums in einer späten Ausprägung, offenbarte andererseits aber auch Züge des renaissancehaften modernen Herrschertypus’. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch im Verhältnis Maximilians zu den Niederlanden wider. Mit Maximilians Wirken verbindet sich ein erster Höhepunkt nicht nur der im engeren Sinne dynastischen Musikpflege im Hause Habsburg, sondern auch der mitteleuropäischen musikalischen Zentrenbildung schlechthin. Folglich markiert die in der Person Maximilians beispielhaft verkörperte mentalitätsgeschichtliche Polarisierung den Ausgangspunkt für etliche weiterführende stil-, lokal-, frömmigkeits- und kompositionsgeschichtliche Grundsatzfragen. Den mannigfaltigen frühneuzeitlichen Phänomenen der Verflechtung von Musik und Politik widmen sich die Beiträge des Bandes aus unterschiedlichen Perspektiven.
-
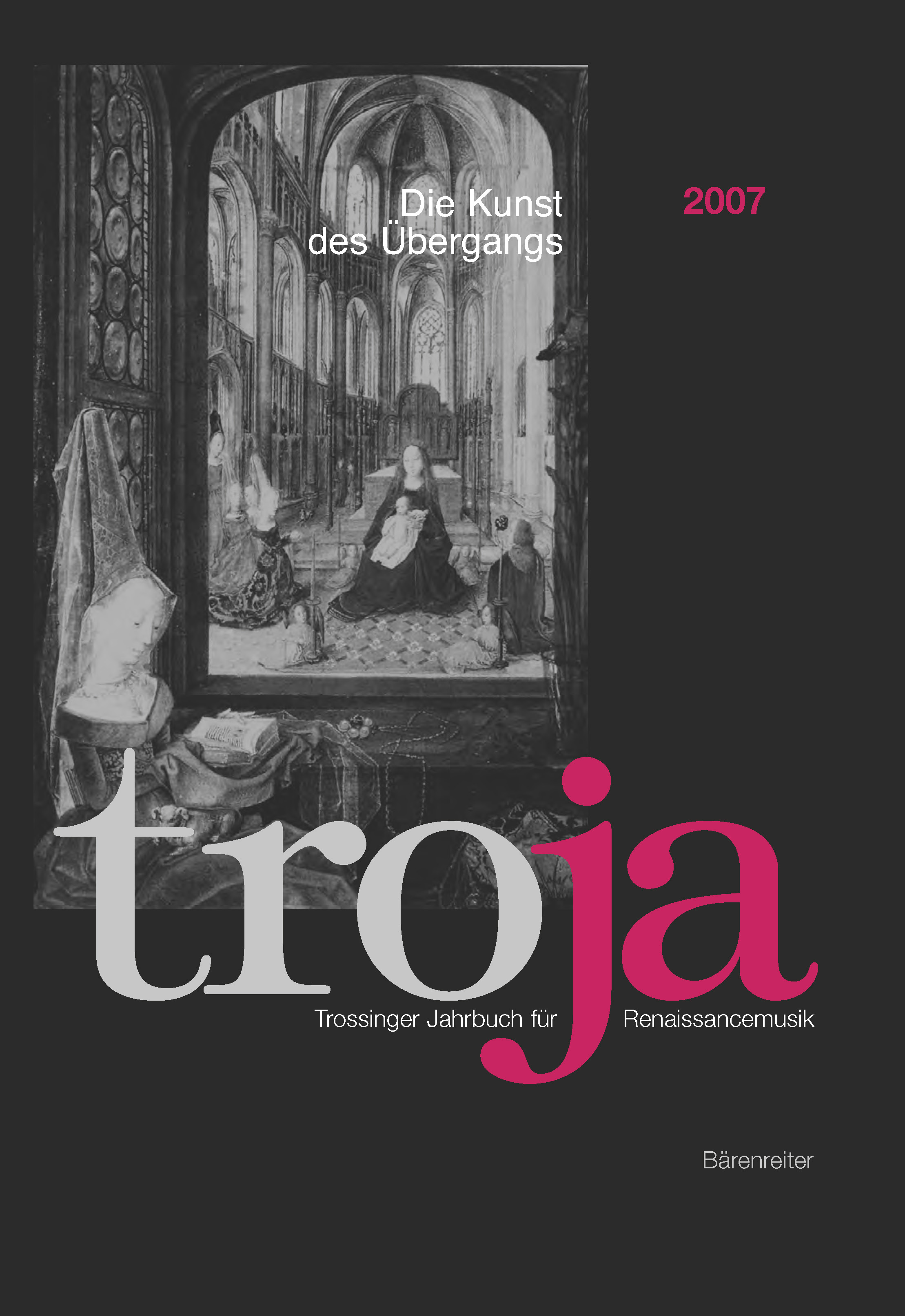
Die Kunst des Übergangs
Bd. 7 (2007)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Dass Musik neue, andere Musik provoziert, gehört zu den überzeitlichen Phänomenen. Für das Denken der Renaissance war jedoch der Übergang in eine andere musikalische Existenzform von besonderer Bedeutung: Parodie und Kontrafaktur, Cantus firmus-Bearbeitung und "Art-song Reworking", Intavolierung und Ornamentierung, Variation, Paraphrase sowie Zitat verdichten sich zu seinem System, das einen ganz spezifischen ästhetischen Wert hat. Die sieben Autoren und Autorinnen des Bandes richten ihren Blick nicht nur auf das Resultat des Umwandlungsprozesses, sondern auch auf den Ausgangsstoff und fragen: Was wird aus der Vorlage? Wird sie verschwiegen, neutral behandelt oder gar akzentuiert?
-

Alexander Agricola. Musik zwischen Vokalität und Instrumentalismus
Bd. 6 (2006)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Der Band dokumentiert das Symposium zum 500. Todesjahr des bereits von seinen Zeitgenossen als ungewöhnlich eingeschätzten Komponisten Alexander Agricola. Bei keinem anderen seiner Kollegen tritt ein Kardinalproblem der Zeit so markant hervor: die Ambivalenz zwischen vokalen und instrumentalen Gestaltungsmerkmalen. Historisch eine Reaktion auf die aufblühende Instrumentalkunst, die neben die florierende Vokalpolyphonie trat, stellt die Mehrdeutigkeit der Partituren heute eine ungelöste aufführungspraktische Herausforderung dar, der sich die Beiträge von Musikern und Wissenschaftlern stellen.