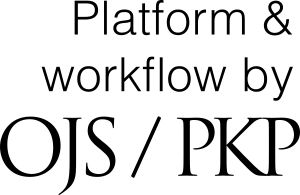Archive - Seite 4
-
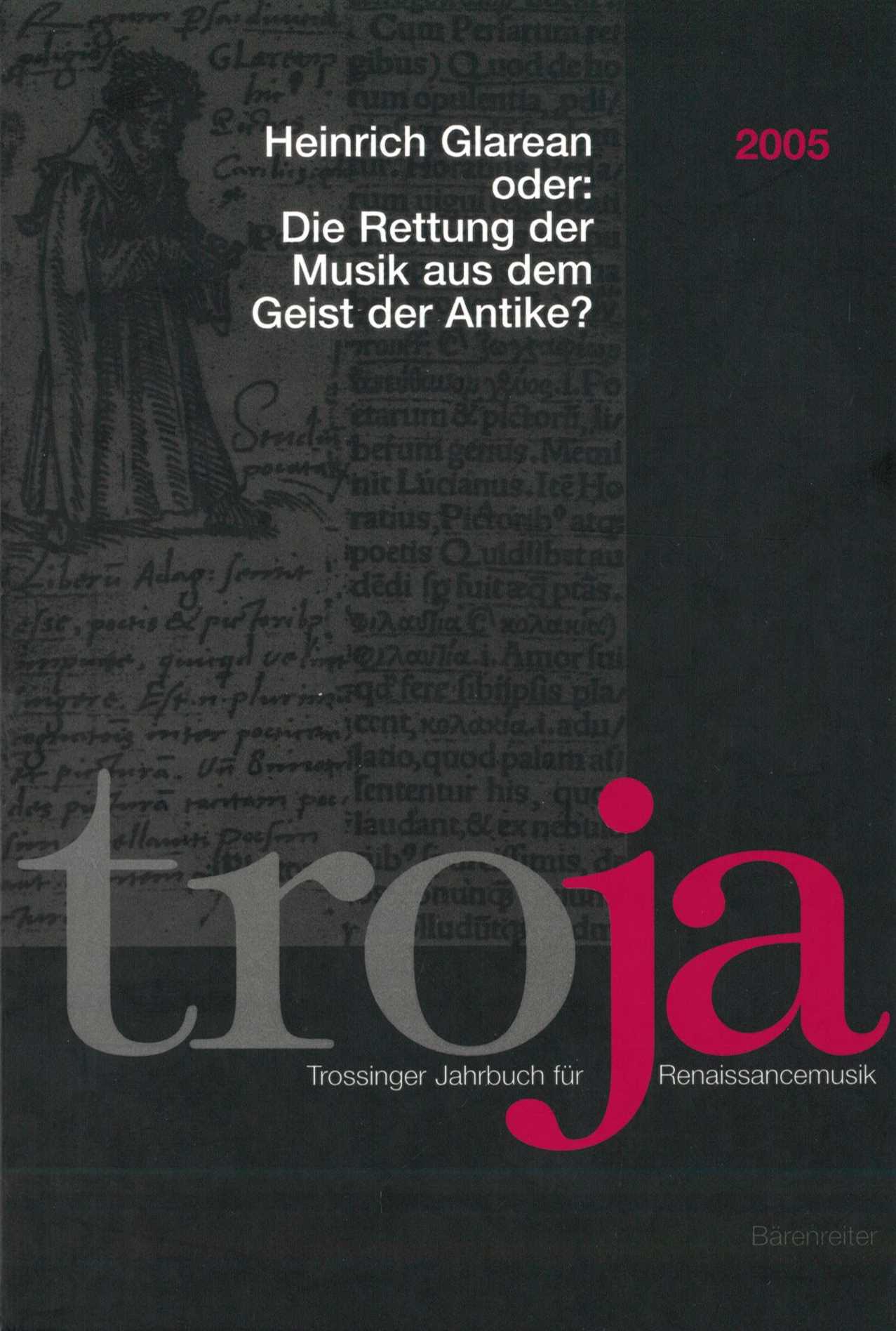
Heinrich Glarean oder: Die Rettung der Musik aus dem Geist der Antike?
Bd. 5 (2005)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Der Schweizer Gelehrte Glarean war nicht nur ein bedeutender Humanist, sondern auch einer der einflussreichsten Musiktheoretiker des 16. Jahrhunderts. In seinem "Dodekachordon", einer der zentralen Schriften der musikalischen Renaissance, tritt er mit keinem geringeren Anspruch auf, als die Musik von Grund auf zu erneuern und damit zukunftsfähig zu erhalten. Aus dieser Motivation entwickelte er auf der Basis antiker Ansätze ein logisch stimmiges Zwölf-Tonarten-System, das von den Gepflogenheiten der mittelalterlichen Lehre und Praxis gereinigt war und das etablierte System der acht Modi ersetzen sollte. Seine musikalisch-weltanschauliche Ambition untermauerte er einesteils mit neu in Auftrag gegebenen Kompositionen, anderenteils mit ausgesprochen eigenwilligen, der herkömmlichen Lehre wie der zeitgenössischen Kompositionspraxis zuwiderlaufenden Analysen bereits bestehender Werke, die in Glareans Sinn den Kern der "Wahrheit" dennoch bereits in sich tragen. Kein Musiktraktat der Zeit enthält so viel konkretes Material zur Anschauung bzw. "Anhörung". Die Beiträge dieses Bandes informieren über die Person und ihr Umfeld und erörtern die Voraussetzungen, Verfahren und Rezeption des musikalischen Denkens von Heinrich Loriti, genannt Glareanus.
-
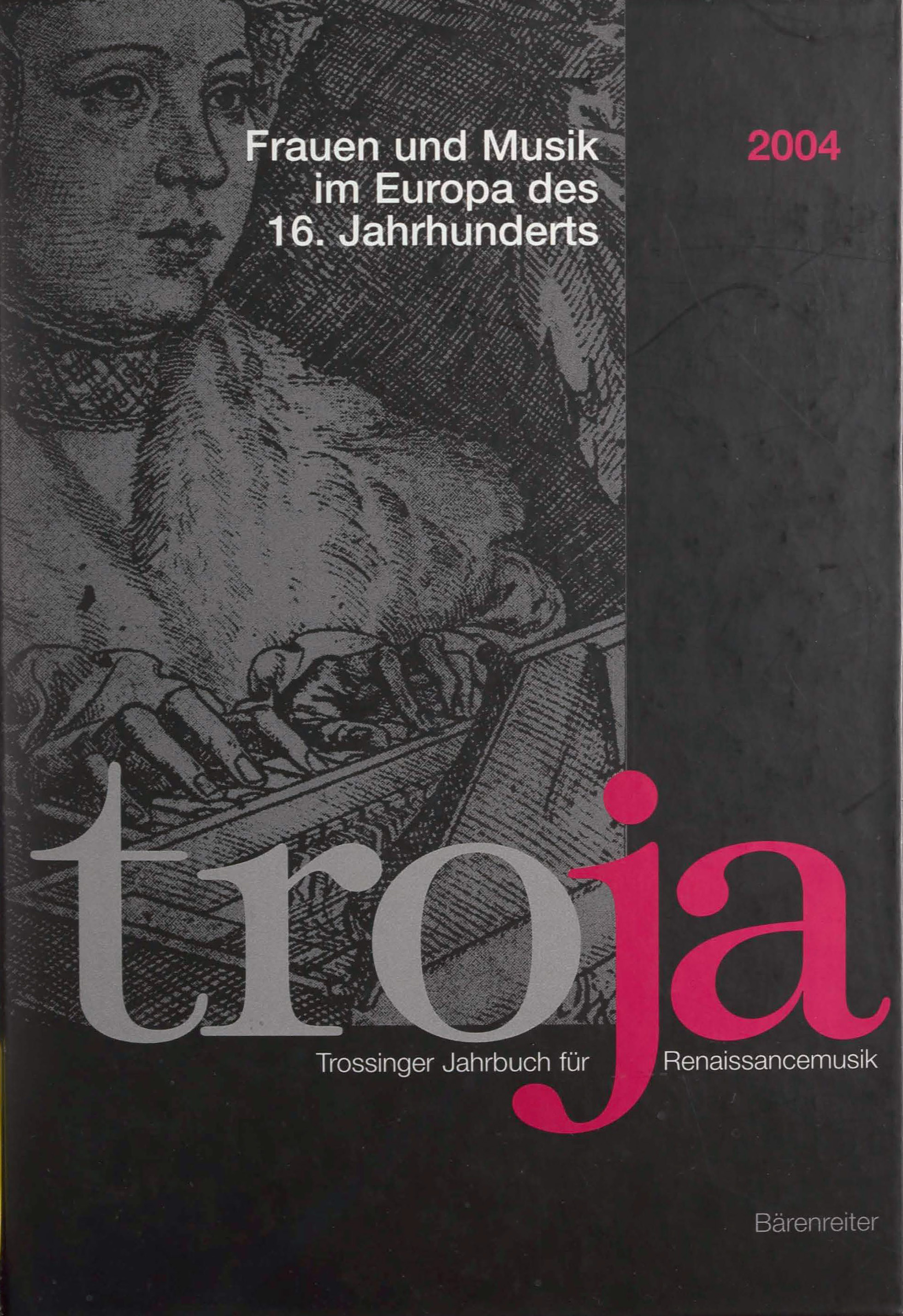
Frauen und Musik im Europa des 16. Jahrhunderts. Infrastrukturen - Aktivitäten - Motivationen
Bd. 4 (2004)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Der inzwischen populären Frauen- und Geschlechterforschung verdankt auch die musikhistorische Forschung unschätzbare Impulse: Auf der Suche nach den "archäologischen" Scharnierstellen, an denen sich moderne Formen einer weiblichen Teilhabe am Musikleben herauszubilden begannen, zeigt sich, dass das 16. Jahrhundert, und hier wiederum Italien, eine Schlüsselfunktion einnahm. Die kulturellen Bedingungen der Renaissance und der entwickelten Hofkultur erlaubten hier erstmals einer Komponistin, ihre Werke zu drucken und damit der Öffentlichkeit vorzustellen, hier wurde der erste Schritt zu hoch angesehenen professionellen Sängerinnen gemacht, Fürstinnen traten selbstbewusst als musikalische Mäzeninnen auf. Aber auch die Verhältnisse in den anderen Ländern Europas geraten in diesem Buch in den Blick: mit ihren je spezifischen Formen von weiblichem Kontakt mit Musik, den mentalen, politisch-gesellschaftlichen und institutionellen Voraussetzungen, Spielräumen und Aktionsfeldern. Ein Akzent der Betrachtung liegt auf der Beleuchtung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Frauen, die Musik förderten, hörten, erlernten, ausübten oder komponierten.
-
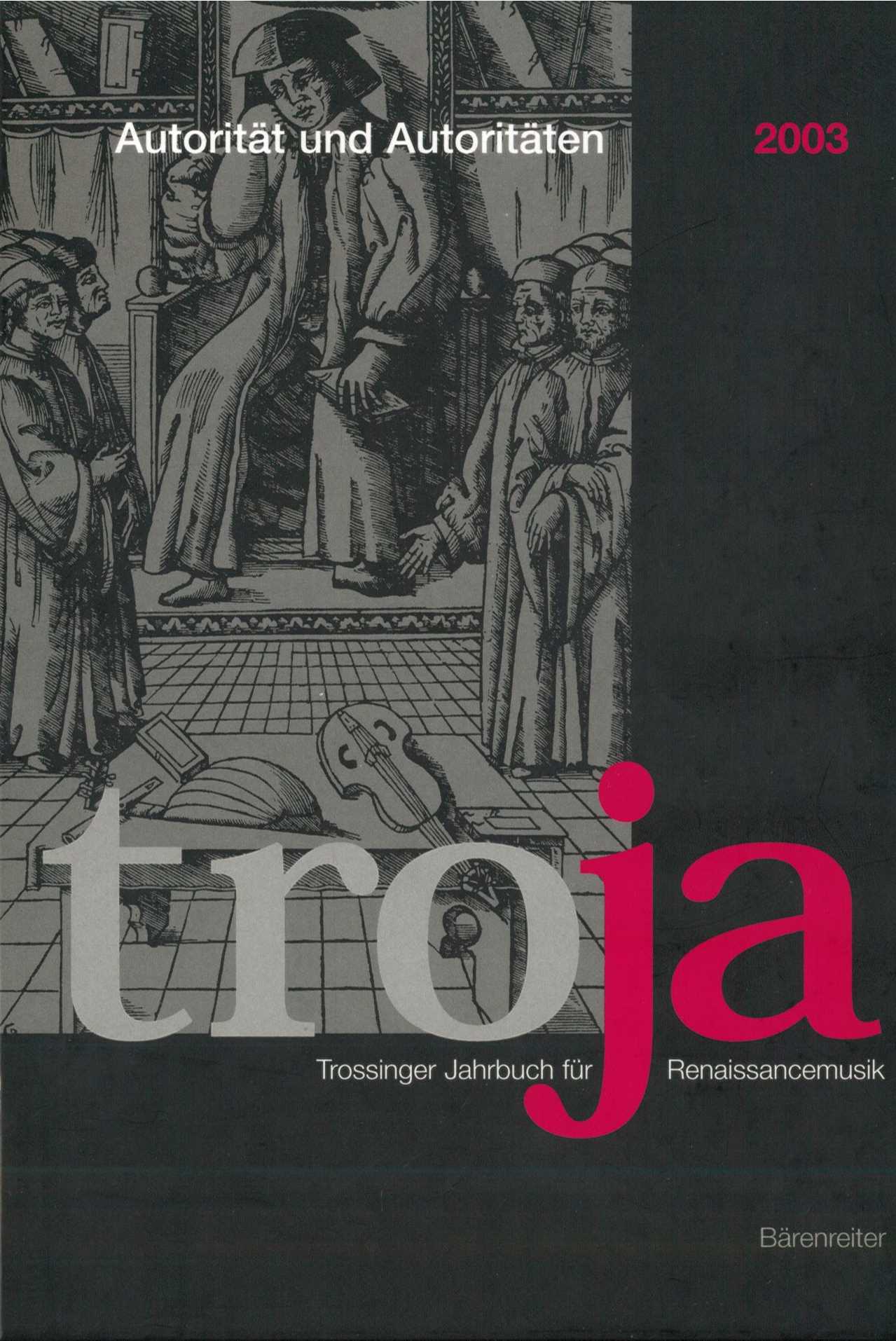
Autorität und Autoritäten in musikalischer Theorie, Komposition und Aufführung
Bd. 3 (2003)Herausgegeben von Laurenz Lütteken und Nicole Schwindt.
Dieser Band des Jahrbuchs "TroJa" vereinigt die Beiträge des dritten Trossinger Symposiums zur Renaissancemusikforschung. Mit unterschiedlicher Akzentuierung behandeln die Verfasserinnern und Verfasser die Konsequenzen für die Musik, als in der Renaissance Individuation und "Selbst-Bewusstsein" in den Vordergrund treten und sich die mittelalterliche Thematisierung von Autorität (als abstrakter Kategorie) und die neuzeitliche von Autoritäten (als personifizierte Repräsentanten) überschneiden. Die immer stärker hervortretende Rolle der Komponisten als "Autoren" lässt sie eigene und Kollegen-Namen vertonen, Komponisten berufen sich musikalisch auf konkrete Werke ihrer Vorgänger, Theoretiker legitimieren Satztechniken mit dem Tun von Komponisten. Auch Instrumentalisten erlangen Anerkennung, indem sie sich der Schrift und der Kompositionslehre zuwenden, und Sänger gewinnen Autorität mehr aufgrund ihres künstlerischen Formats als durch ihre Zugehörigkeit zu einer Institution. Schließlich profitiert im Falle Spaniens das Selbstbewusstsein einer ganzen Nation von der Autorität eines eigenen musikalischen Auftritts.
-
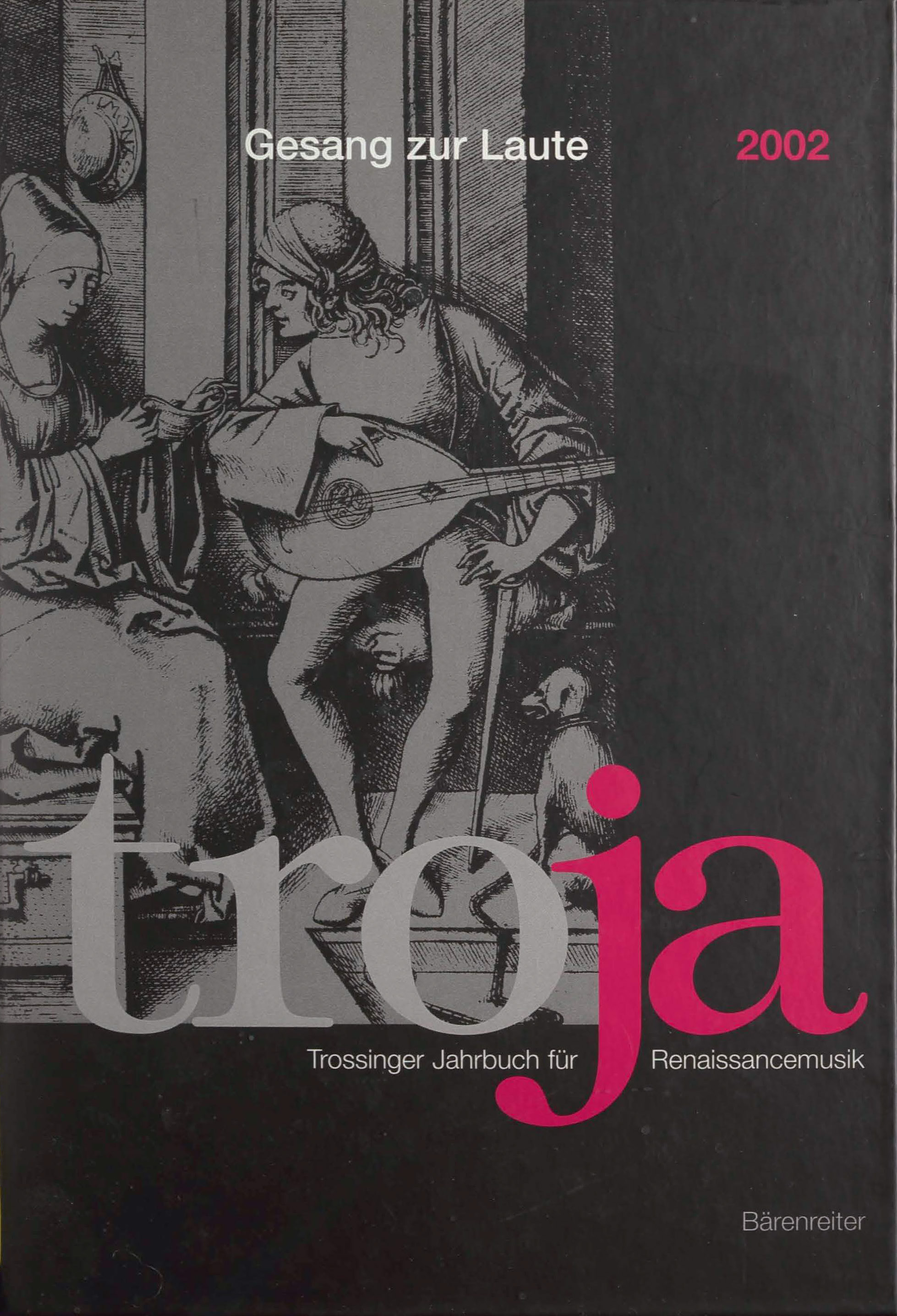
Gesang zur Laute
Bd. 2 (2002)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Der zweite Band thematisiert das Singen zur Laute, von dem literarische wie bildliche Zeugnisse eindrucksvoll veranschaulichen, dass es vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in ganz Europa die wichtigste Form des Musizierens außerhalb der Kirche war: im höfischen Leben wie auf vielen anderen sozialen Ebenen, auch wenn das nicht immer in den erhaltenen Notendokumenten oder der Art, wie Renaissancemusik heute aufgeführt wird, zum Ausdruck kommt. Die Beiträge beschäftigen sich aus mehreren Blickwinkeln mit den Übergängen zwischen improvisierter und komponierter Musik und mit den Schwierigkeiten, eine mündliche Tradition mit den Bedingungen der schriftlichen Fixierung zu vereinbaren. Die vielfältigen Ideen, die hinter der Praxis stehen und sich mit ihr verbinden, werden diskutiert, und es wird nach der Funktion des lautenbegleiteten Sologesangs in verschiedenen kulturellen und geographischen Zusammenhängen gefragt.
-
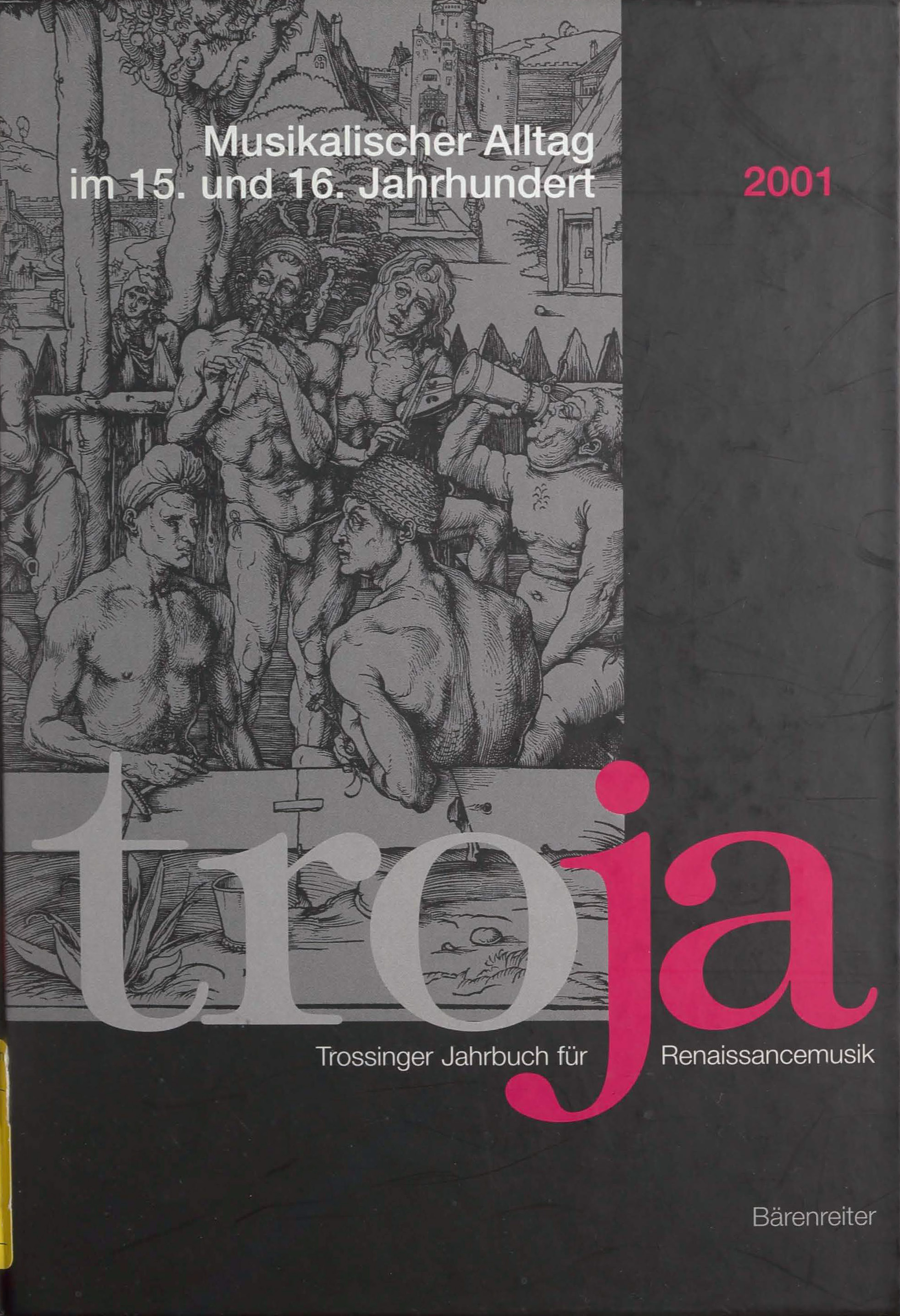
Musikalischer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert
Bd. 1 (2001)Herausgegeben von Nicole Schwindt.
Das neue Jahrbuch "TroJa" vereinigt die Beiträge der jährlichen Trossinger Symposien zur Renaissancemusikforschung mit weiteren Aufsätzen zu den jeweiligen Themen. Der erste Band beschäftigt sich mit Fragen des musikalischen Alltags im 15. und 16. Jahrhundert und mit der Verarbeitung von Alltagsgegebenheiten in Kompositionen der Zeit. Lebensbereiche wie der französische Königshof und der Münchner Herzogshof sind neben dem bürgerlichen Milieu der Kaufleute und den Straßenbühnen der Quacksalber in den Blick genommen. Die europaweite Praxis des Verfassens und Singens von Liedern wird dargestellt, und mit Beiträgen über das Eindringen der Schriftkultur in die frühe Instrumentalmusik, über Reflexe des neuzeitlichen Körperbewusstseins und über die Hilfen, die man sich von der Musik bei der Erlangung des Seelenheils und bei venerischen Krankheiten versprach, werden mentalitätsgeschichtliche Aspekte thematisiert.